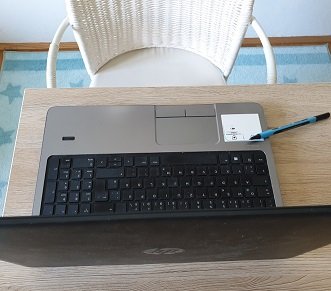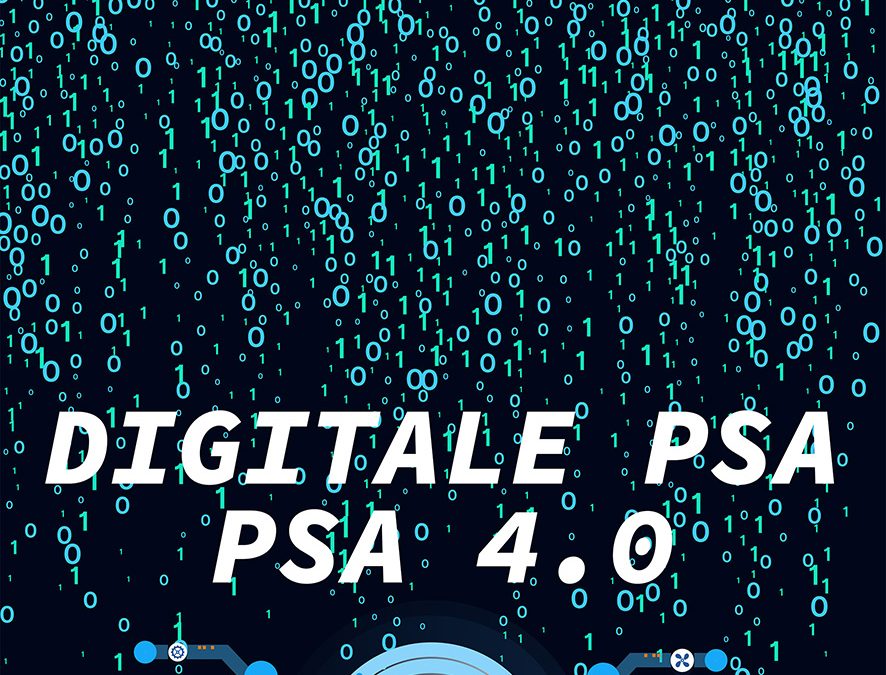In der M.A.S. 4/19 stand das „Arbeiten unter null Grad“ im Mittelpunkt, dieses Mal greifen wir in unserem PSA-Schwerpunkt abermals das Thema „Digitale PSA – PSA 4.0“ auf.
Wir geben Ihnen auf den nächsten Seiten einen tieferen Einblick ins Thema „Digitale PSA – PSA 4.0“, skizzieren die diesbezüglich neuesten Entwicklungen am Markt und die Trends der Zukunft. Zudem haben wir wie gewohnt Experten aus der Praxis befragt. Aus Platzgründen ist es uns hier jedoch NICHT möglich, Details v.a. zu Kennzeichnungen, Normen etc. zu erörtern. Diesbezüglich empfehlen wir Ihnen unsere neue M.A.S.-Serie zu „Normen & Kennzeichnung“ (eine Übersicht der bisher erschienenen Beiträge finden Sie in der M.A.S. 4/19 im Infoservice auf Seite 3), das „Handbuch Persönliche Schutzausrüstung“ des VAS (siehe Kasten Infoservice S. 14) sowie vertiefend zu Normen das Austrian Standards Institute. Einen aktuellen Bezugsquellennachweis, bei welchem VAS-Mitgliedsunternehmen Sie welche Persönliche Schutzausrüstung beziehen können, finden Sie auf den Seiten 16-17.
Digitale PSA: Schutzausrüstung im Kontext Industrie 4.0
Ein Gastbeitrag von René Höller, Stuco GmbH, und Alexander Roitner, SCHÜTZE-SCHUHE GmbH
Wir haben uns in vergangenen Ausgaben bereits dem Thema PSA im Kontext zu Industrie 4.0 gewidmet, indem wir das Thema allgemein beschrieben und die Sinnhaftigkeit bzw. die Einsatzgebiete dieser Entwicklung erörtert haben. In diesem Artikel möchten wir uns nun die wichtigsten Bestandteile der digitalen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) genauer ansehen und auch hier die Vor- und Nachteile herausarbeiten.
Zu Beginn unserer Ausführungen beschäftigen wir uns mit der Frage, worin eigentlich der Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen PSA liegt.
Definition von analoger und digitaler PSA
Als (analoge) PSA gilt jede Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern benutzt oder getragen zu werden, um sich gegen eine Gefahr und für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen, sowie jede mit demselben Ziel verwendete Zusatzausrüstung. Unter „digitaler“ Persönlicher Schutzausrüstung wird PSA verstanden, die mit Sensoren und Aktoren ausgestattet ist und in Verbindung mit Software 4.0 Informationen über den Zustand der PSA, deren Nutzung und den Träger liefert.
Die bereits bekannten sind
- Digitale PSA: mit Sensoren/Aktoren ausgestattet – wie Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Atemschutz, Handschuhe, etc.
- Smart Clothes: mit Sensoren/Aktoren ausgestattet – Beispiel Arbeitsbekleidung, T-Shirts
- Wearables:0 Technologie, die am Körper getragen wird, wie Smart Clothes, Armbänder, Brillen
Der Arbeitsplatz der Zukunft
Der Arbeitsplatz der Zukunft wird sich durch die Existenz interagierender und vernetzter Objekte auszeichnen, die heute bereits unter dem Begriff cyber-physischer Systeme (CPS) bekannt sind. Wesentliche Bestandteile eines CPS sind mobile und/oder bewegliche Einrichtungen, Geräte, Maschinen, Roboter, eingebettete Systeme und vernetzte Gegenstände (Internet of Things).
Die verschiedenen Objekte einer Arbeitsumgebung stellen hierbei die physische oder virtuelle Identität eines konkreten oder abstrakten Gegenstandes dar, wie etwa von Maschinen, Anlagen, Werkzeuge oder Applikationen. CPS sind autonome Systeme, bei denen informations- und softwaretechnische mit mechanischen Komponenten verbunden sind. Der Datentransfer und Datenaustausch sowie die Kontrolle bzw. Steuerung erfolgen in Echtzeit über eine Kommunikationsinfrastruktur. Diese Infrastruktur kann u. a. auf einem offenen, globalen Informationsnetzwerk oder auf einem firmeninternen, sicheren Informationsnetzwerk basieren.
CPS im Rahmen der digitalen PSA
Analoge Sicherheits- und Schutzsysteme in der Industrie 2.0 trennen entweder die beteiligten Akteure (Arbeiter, Maschinen, Anlagen, Prozesse) voneinander, um Gefährdungen zu vermeiden, oder schützen sie jeweils autonom. Die Trennung von Arbeiter und Anlage führt jedoch zu einer eingeschränkten Flexibilität im Produktionsablauf. Der autonome Schutz des Arbeiters wird etwa durch die Nutzung von PSA und durch technische Einrichtungen an Anlagen wie Überspannungsschutz oder Überdruckventile realisiert. In der Industrie 4.0 haben aber schon seit einiger Zeit cyber-physische Systeme eine wichtige Funktion übernommen. Sie steuern heutzutage schon Arbeitsmittel, Produkte, Räume, Prozesse und teilweise auch schon den Menschen. Dadurch sind auch neue Möglichkeiten zur Entwicklung und Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung in Arbeitsprozessen 4.0 geschaffen worden. Diese neue Art der PSA ist proaktiv und intelligent und ermöglicht seinen Nutzerinnen und Nutzern einen erweiterten oder zusätzlichen Schutz. Digitale PSA kann aktiv Aktionen oder Maßnahmen zum Schutz des Anwenders auslösen. Durch die laufende Verarbeitung der Daten während der Anwendung kann PSA 4.0 zusätzliche Schutzfunktionen freigeben, auf die Gefährdung durch schädigende Umgebungseinflüsse hinweisen, warnen bevor in stark belastenden Arbeitsbereichen Grenzwerte überschritten werden und im schlimmsten Fall autonom ein Meldung über einen Notfall auslösen.
Die während der Anwendung gewonnenen Daten können dann wiederum für die Adaptierung von bestehenden Arbeitsprozessen in einen Arbeitsprozess 4.0 genutzt werden. Selbstverständlich müssen dabei aber auch einige Themen für einen produktiven und gesundheitsgerechten Arbeitsprozess beachtet werden.
Digitale PSA kann in Wechselwirkung mit geeigneter Unternehmenssoftware sicherstellen, dass ausgewählte Orte wirklich nur mit geeigneter PSA zugänglich sind (Access Systeme). Gerade im Bereich der PSA-Kategorie III können auch Informationen geliefert werden über Lagerorte, Prüfintervalle, Nutzungsdauer und von wem sie wann benutzt bzw. wie lange sie getragen wurde. Bewegungsprofile lassen sich über GPS-Daten genau darstellen, wobei wir bei diesem und ähnlich gelagerten Informationen schon in unserem früheren Beitrag auf die Problematik des Datenschutzes hingewiesen haben.
Chancen und Risiken von digitaler PSA
Chancen sind etwa die Erhöhung der Sicherheit, eine frühe Wahrnehmung von Gefahrensituationen und die akkuraten Reaktionen darauf. Weiters: Vermeidung von falscher Benutzung der PSA; Einsatz von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen durch technische Hilfeleistung (z.B. bei Allergiker); proaktive Erkennung potenzieller Gefahren; schnellere und sicherere Signale bei Notfall; Informationen über Nutzungsverhalten der Träger, deren Vitaldaten, Arbeitsweise, Zustand und Nutzung der PSA; Hinweise auf schädigende Umwelteinflüsse, bevor sie zur Gefährdung werden; Unterstützung von Arbeitsprozessen durch Einbeziehung von PSA.
Zu den Risiken durch den Einsatz von digitaler PSA zählen fehlerhafte und/oder unvollständige Daten, die zu falschen Entscheidungen führen. Das Thema Datenschutz ist durch das Auslesen bei personenbezogenen Daten, wie Vitaldaten, Bewegungsprofile und dergleichen ein sehr großes Thema und noch nicht geregelt. Weiters: Verlust von Intuition zu gefährlichen Situationen; zusätzliche Gefährdung bei Ausfall der Technik – unzureichende Zuverlässigkeit, Schaffung von zusätzlichen Gefahrenquellen und der Kostenfaktor.
Bereits umgesetzte Projekte
Dazu zählen u.a. Warnfunktion durch Überwachung von Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel Schadstoffe in der Luft, Kühl- bzw. Heizfunktion, die die Körper- und Außentemperatur messen und bei Ungleichgewicht aktiv werden, Überwachung von Körperfunktionen und des Arbeitsbereiches in Realtime mittels Sensoren, die im Einsatzfall, wie zum Beispiel bei Feuerwehrmännern, die Strategie der weiteren Einsatzmaßnahmen beeinflussen kann. Zu diesen Daten gehören Schadstoffgehalt, Hitzentwicklung und dergleichen, die über Sensoren in der Feuerwehrbekleidung gemessen werden. Diese Funktionen sind bis dato realisiert worden und tragen zu einer Minimierung des Verletzungsrisikos bei. Am Markt gibt es auch aktive PSA, die als „Notaus“ fungiert, sobald die Gesundheit des Trägers in Gefahr ist. Christof Breckenfelder, Projektleiter Schnittschutzhose „Horst“, hat mit seinem Team eine Hose für Holzarbeiten entwickelt, die mit der Motorsäge kommuniziert. Im Falle eines drohenden Unfalls (stolpern oder ausrutschen) sorgt die Sensorik der Hose dafür, dass ein Signal an die Motorsäge übertragen wird, die den Motor sofort ausschaltet, bevor die Kettensäge die Schutzbekleidung erst berührt.
Weitere Einsatzgebiete, die bereits in die Praxis umgesetzt wurden: Sensorische Näherungsdetektion beim Umgang Mensch, Maschine, Fahrzeug; Beobachten und Speichern von Historien und Gefährdungsparametern zur Erfassung von Gewöhnungseffekten und Gefährdungstoleranzen; Verstärkung von Signalen trotz Gehörschutz, zum Beispiel durch Vibration.
Maßnahmen bei der Beschaffungsentscheidung
Beim Kauf von digitaler PSA, die über „normale“ PSA hinausgeht, sollten neben den allgemeinen Anforderungen an PSA unter anderem folgende Maßnahmen eingebunden werden:
Bei der Beschaffung muss klar sein, welche Daten erhoben werden und welche für das Unternehmen wichtig sind. In diesem Kontext stellen sich dann aber auch einige Fragen:
- Wem gehören diese Daten, wer nutzt sie, wer kann sie sehen, wie werden sie ausgewertet, wo und wie lange werden sie gespeichert (Stichwort Cloud) und in welchem Kontext werden sie verwendet?
- Können die Daten gelöscht, widerrufen und/oder manipuliert werden?
- Sind die Daten mit der Unternehmenssoftware kompatibel, welche Schnittstellen zu anderen smarten Arbeitsmittel sind sinnvoll und wie müssen diese umgesetzt werden?
- Welche Auswirkungen hat der Einsatz von digitaler PSA auf interne Prozesse und deren Planung?
Im Einsatzfall müssen Beschäftigte auf Chancen und Risiken hinweisen, um Akzeptanz zu erhöhen bzw. zu fördern. Unternehmen müssen mit betroffenen Mitarbeitern (Nutzern von PSA 4.0) vereinbaren, welche Daten die digitale PSA erheben und wie sie verwendet werden. Alle Beteiligten müssen unterwiesen und durch dementsprechende (innerbetriebliche) Ausbildungen zu diesem Thema gefördert werden. Zudem muss digitale PSA in die Gefährdungsbeurteilung und Wirksamkeitskontrolle eingebunden werden (Sensoren/Aktoren vor Einsatz auf Funktionsfähigkeit prüfen; Erfahrungswerte dokumentieren und kommunizieren, um Verbesserungen abzuleiten).
Was bedeutet der Wandel in Richtung PSA 4.0?
Technik vor Organisation, vor persönlichen Maßnahmen (PSA) – das war bisher die Reihenfolge im Arbeitsschutz bei zu wählenden Schutzmaßnahmen. Die spannende Frage, die sich nun stellt, ist die Betrachtungsweise von digitaler PSA. Ist digitale PSA weiterhin nur eine „persönliche Maßnahme“ oder muss sie nun als Teil der „Technik“ gesehen werden und damit an die 1. Stelle der Reihenfolge rücken? Wie auch immer: Am Ende des Tages steht die unbedingte Notwendigkeit von PSA, die unter dem Synonym PSA 4.0 sicherlich eine bedeutende Aufwertung erfahren wird. Ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Verantwortungs- bzw. Haftungsfrage zwischen Unternehmen/Produzenten, die schlüssig geregelt sein muss.
Quellen: Breckenfelder, C. (2013). Mobile Schutzassistenz; Gabler Wirtschaftslexikon; Verbundprojekt Prävention 4.0, Offensive Mittelstand, Heidelberg 2018; Lee, E. A.: Cyber Physical Systems: Design Challenges, Tec. Report No. UCB/EECS-2008-8.
Lesen Sie mehr zum Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe der M.A.S. im Infoservice auf den Seiten 9-14.